Fontane macht es seinen Leserinnen und Lesern nicht leicht – damals nicht und heute erst recht nicht. Irritierte die Zeitgenossen wohl eher eine sich auf äußerster Schwundstufe entwickelnde Handlung, so erschwert uns Heutigen der voraussetzungsschwere Anspielungsreichtum die Lektüre. Ohne erläuternde Kommentare ist Stine selbst für den an historischen Vorkenntnissen reichen Leser kaum noch mit Genuss und Freude lesbar. Der Roman – oder sollten wir den gut 100 Seiten langen Text nicht eher „Erzählung“ nennen? – ist in seinem so kunstvollen Aufbau und seinen verästelten Texturen ansonsten kaum noch so umfassend rezipierbar, wie es ihm zugleich zustehen sollte.
Wir kennen Fontanes Äußerungen zum Stellenwert der ersten Seite für die Romankonstruktion. So auch hier! Wie in einer einzigen Kamerafahrt, ohne erkennbaren Schnitt und mit wenigen Schwenks, zoomt der Erzähler von der in der Totalen wahrgenommenen Invalidenstraße in Berlin zur vorauskommentierenden Perspektive einer Nebenfigur, welche wie beiläufig abgelauscht wird, hin zur gegenüberliegenden Straßenseite bis in die Stube der Witwe Pittelkow, die gerade die Fenster geputzt hat. Es scheint beinahe, als würde Fontane mit erzählerischen Mitteln die berühmte Kamerafahrt aus der Eingangssequenz von Hitchcocks „Pyscho“ vorwegnehmen.
Nun ja, vielleicht ist diese Assoziation etwas arg subjektiv. Aber hier wie dort beschleicht einen ein mulmiges Gefühl. Im Roman jedoch passiert, wenn man als Leser nicht aufmerksam bleibt, erst einmal sechs Kapitel lang – nichts; zumindest nicht viel. Da treffen sich, so viel bekommt man auch bei flüchtigerer Lektüre mit, sechs Personen in der Wohnung der Witwe Pittelkow, drei Männer, drei Frauen. Diese Begegnung hat etwas Intrikates, das sich vielleicht nicht gleich erschließt. Der die Gesprächsszenen dominierende Graf von Haltern hat offenbar ein intimes Verhältnis zu der Witwe und ist wohl auch der Vater ihrer Tochter Olga. Diese illegitime Beziehung bildet die ökonomische Grundlage für das Leben der Witwe Pittelkow, offensichtlich aber um den Preis, dass der alte Graf meint, sich doch eine Menge herausnehmen zu können. Er bezahlt nicht nur, sondern bestimmt auch weithin die Einrichtung ihrer Wohnung. Er kommt und er geht, wann es ihm passt.
So auch an diesem Nachmittag, den er nur sehr kurzfristig vorher angekündigt hatte. Er bringt einen Freund mit, einen Baron, der nach der Figur aus Mozarts „Zauberflöte“ Papageno genannt und dessen Klarname niemals erwähnt wird. Begleitet werden die beiden Herren vom Neffen des Baron, Waldemar von Haldern. Auf der Seite der Frauen wird das Sextett komplettiert durch Wanda Grützmeier, eine Freundin der Witwe und selbst Schauspielerin, sowie durch Stine Pittelkow, der jüngeren Schwester der Hausherrin. Die jeweils Letztgenannten, also der junge von Haldern und Stine, wirken in diesem Ensemble wie Fremdkörper und scheinen in die Gruppe überhaupt nicht hineinzupassen. Die in den Gesprächen hin und her fliegenden Anspielungen und Anzüglichkeiten sind ihnen erkennbar unangenehm. Aber dadurch erhält das Oberflächliche, das Scheinhafte und Gekünstelte der Szenerie und der Unterhaltung wie auch das anzüglich Bigotte eine genauere Ausleuchtung.
Gerade hier, wo Vertreter des Adels Vertreterinnen unterer sozialer Schichten begegnen, erweist sich die starre soziale Undurchlässigkeit der preußisch-wilhelminischen Gesellschaft. Gespielt wird nach den Regeln jener, die meinen, aufgrund überkommener Privilegien, fragwürdiger Verdienste wie auch aufgrund ihrer Mittel, das Recht dazu zu haben. Ihr Protagonist und Regisseur ist der alte Graf von Haldern, Waldemars Onkel. Seinem Verhältnis zur Witwe Pittelkow ist geradezu konstitutiv, dass das Gefälle zwischen Oben und Unten gewahrt bleibt. Alles andere ist für ihn nicht akzeptabel; wie sich zeigen wird.
Aber da wären ja noch die beiden jungen Menschen, die in dieses bizarre Gesellschaftsspiel nicht hineinpassen. Dieses erste Zusammentreffen der Beiden ist zunächst einmal Ausgangspunkt dafür, dass Waldemar fortan die Nähe Stines sucht und sich in sie verliebt. Diese Beziehung steht unter anderen Vorzeichen als die zuvor gezeigten Verhältnisse. Das liegt an beiden Protagonisten. Stine macht gleich beim ersten Besuch unmissverständlich klar, dass sie die Lebensweise ihrer Schwester zwar akzeptiere, für sich selbst aber grundsätzlich ausschlösse und sich einer sexuellen Liaison verweigere. Waldemars Liebe zu ihr erscheint durchaus authentisch und die Absicht, sie zu heiraten, ernsthaft. Er ist nicht blind und naiv gegenüber der offensichtlichen Unstandesgemäßheit seiner Liebe und sucht nach Auswegen, findet aber nur einen: die gemeinsame Flucht nach Amerika. Dass eine die Standesgrenzen sprengende Ehe in seiner Familie akzeptiert würde, schließt er aus guten Gründen aus. Dennoch sieht er sich bemüßigt, seinen Onkel um Verständnis für seinen Ehewunsch und seine Pläne zu bitten. Damit scheitert er kläglich. Die entscheidende Wendung nimmt die Geschichte aber erst, als er Stine als letzte in seine Absichten und Überlegungen einweiht.
In einem großartigen Dialog im 14. Kapitel des Romans, der dem zwischen Innstetten und Wüllersdorf in Effi Briest in seiner Ausleuchtung der Seelenbefindlichkeiten und Bewusstseinslagen kaum nachsteht, verhandeln beide ihre Positionen. Stine hält Waldemars Ansinnen für aussichtslos:
Du willst nach Amerika, weil es hier nicht geht. Aber glaube mir, es geht auch drüben nicht.
Ihr Hauptargument fußt auf der Annahme, dass die individuelle Standesgebundenheit beider ein gelingendes gemeinsames Leben nicht ermögliche, egal wo. Eine von außen betrachtet deprimierende, aus dem Inneren der Romankonstruktion und der Anlage der Figuren heraus realistische Einschätzung. Es kommt zu dem, was aus dieser Logik heraus kommen muss: Waldemar begeht Suizid.
Im letzten Kapitel des Romans, dem Begräbniskapitel, werden die thematischen Fäden in einer Weise gebündelt, die Stines Befürchtungen bestätigt. Die geschilderte Zeremonie führt den toten Waldemar von Haldern mit allem Begräbnispomp, in den Kreis zurück, dem er den Rücken kehren wollte, und lässt Stine nur am buchstäblichen Rande daran teilnehmen.
Zwei sehr einprägsame und korrespondierende Schlussbilder prägen das Ende des Romans. Da ist zum einen die Witwe Pittelkow, die ihre Schwester mit einem recht banalen und wenig hilfreichen Blick in die Zukunft zu trösten versucht. Da ist zum anderen die unerträgliche Frau Polzin, die im gleichen Haus, aber eine Etage über der Wohnung der Witwe, ein Zimmer an Stine vermittelt hat. Einmal mehr lauscht sie an der Tür, als Stine wieder nach oben kommt und in ihr Zimmer geht, um ihrem Mann dann sagen zu müssen: „Die wird nich wieder.“
Also alles ganz hoffnungslos? – Nicht ganz.
In Stine legt Fontane mit einem Arsenal von letztlich nur acht Figuren ein Skalpell an gesellschaftliche Verhältnisse. Sein kunstvoller Querschnitt ermöglicht quasi einen histologischen Befund, dem aber nun einmal ein Ist-Zustand eigen ist und nicht der in die Zukunft gerichtete Blick. Das schließt jedoch auf einer den Leser steuernden rezeptionsästhetischen Ebene Kritik ebenso wenig aus wie die Andeutung von Veränderungsmöglichkeiten. Aber: nein, sie werden nicht gebunden an die beiden Opfer der Verhältnisse, an Stine und Waldemar. Die eine nimmt zwar standesgebundene Rollen sensibel, zugleich aber auch statisch wahr und findet sich damit ab. Der andere sieht nur den Freitod als Konsequenz seines Scheiterns und zeigt so auf tragische Weise seine normative Gebundenheit.
Es ist die Witwe Pittelkow, die selbstbewusst in der Lage ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse anders auszuleuchten. Sie akzeptiert zwar die Beziehung zum alten von Haldern, um ökonomisch sicher leben zu können. Aber sie gestaltet es von ihrer Seite her weniger nach feudalgesellschaftlichen als nach kapitalistischen Bedingungen und Spielregeln. Man mag das zunächst für belanglos halten, aber sie schafft sich damit weitere Spielräume. Sie entwickelt ein Klassenbewusstsein, das sie dem Grafen entgegenzuhalten versteht, als der ihr vorwirft, seines Neffen Heiratspläne eingefädelt zu haben. Das 13. Kapitel von Stine, in dem die Witwe Pittelkow den Grafen mit aller unmissverständlichen Deutlichkeit und selbstbewusst in seine blasierten Schranken weist, behauptet in Fontanes Erzählwerk hinsichtlich der Schärfe an Gesellschafts- und Herrschaftskritik eine Sonderstellung.
Stine wurde 1890 im Verlag von Fontanes Sohn Friedrich in Buchform erstveröffentlicht. Damit reiht sich der Roman in eine Lebens- und Arbeitsphase des Autors ein, die durch eine recht schnelle Abfolge von Buchpublikationen geprägt war. In einem Zeitraum von nur drei Jahren erschienen gleich vier Romane Fontanes: Irrungen, Wirrungen (1888), Stine (1890), Quitt (1890, mit Impressum 1891) und Unwiederbringlich (1891, mit Impressum 1892). Den ersten drei genannten Romanen ist gemeinsam, dass sie eine recht lange Entstehungszeit begleitet. Bei Stine sind die Anfänge am Roman bis ins Jahr 1881 zurückzuverfolgen.
Die Texte sind dabei auch thematisch und vor allem motivisch miteinander verbunden. Das auch schon in früheren Romanen aufgeworfene Motiv des Selbstmords verbindet Stine und Unwiederbringlich; das Amerika-Motiv Stine mit Quitt. Deutlich wird aber auch die jeweils andere Auflösung der Motivketten. In Unwiederbringlich ist es die Frau, Gräfin Christine Holk, die sich das Leben nimmt; hier der ebenfalls physisch und psychisch belastete junge Graf. In Quitt wird eine erfolgreiche Flucht nach Nordamerika durchbuchstabiert, die in Stine schon in der Planungsphase scheitert.
Am Augenscheinlichsten – und darauf wurde auch immer wieder hingewiesen – sind die Parallelen zu Irrungen, Wirrungen. Hier wie dort ist die unstandesgemäße Beziehung zwischen einem Adligen und einer jungen Frau aus unterer bürgerlicher Schicht das Generalthema des Romans. Hier wie dort wird uns eine weibliche Hauptfigur vorgestellt, die mit größerer Klarheit und größerer Entschiedenheit als ihr jeweiliges männliches Pendant die Zukunftsfähigkeit ihrer Liebe im Blick hat und weiß, dass ihr unter den gegebenen Verhältnissen keine Dauerhaftigkeit beschert sein wird. Hier wie dort sind die Frauen so selbstreflexiv und klug, zu wissen, dass ihnen die Möglichkeiten und die Mittel fehlen, die Verhältnisse zu verändern.
Lene Nimptsch und Stine Pittelkow also als Schwestern im Geiste und in sozialer Eingebundenheit? Weithin, aber doch nicht so, dass man auf den einen Roman verzichten möge, weil man die Konstellation und deren Ende ja schon kennt. Fontane erlaubt seinen Leserinnen und Lesern in Irrungen, Wirrungen tiefere Einblicke in das Innenleben seiner Hauptfiguren als in Stine. Die Figuren sind in ihrer Individualität komplexer gezeichnet. Während sich Lene Nimptschs Verhalten und Denken weniger an normativen Vorgaben oder an festgezurrte Glaubenssätze orientiert, erschein Stine statischer, gebundener. Das gilt im Vergleich zu Waldemar von Haldern auch für Botho von Rienäcker. Seine Frau Käthe, die er standesgemäß heiratet und die Beziehung zu Lene beendet, ist eine ausgesprochen nervige Frau. Aber die Standesgemäßheit seine Ehe lässt ihn überleben. Waldemar hingegen erkennt bei aller Bewusstheit über die Nichtsnutzigkeit seines Standes keine lebbaren Alternativen. Nach Stines Zurückweisung ist der Freitod die für ihn einzig schlüssige Konsequenz. So wenig es für Stine einen Gideon gibt, der besser sein könnte als Waldemar, so wenig gibt es für den jungen Grafen eine Käthe.
Beim Vergleich der beiden Romane kann es aber nicht um die Frage gehen, wer der gelungenere, wer der weniger gelungenere ist. Bei aller Vergleichbarkeit bleibt doch auch ihre Verschiedenheit. Stine ist der düsterere Roman, ohne Zweifel. Seine Düsternis aber stellt ihn nicht über oder unter Irrungen, Wirrungen, sondern daneben.
Theodor Fontane: Stine. Herausgegeben von Christine Hehle. – Berlin: Aufbau Verlag 2000 (Große Brandenburger Ausgabe. Das erzählerische Werk, Band 11).
Kleiner Nachtrag zur Editionslage
In einigen Taschenbuchverlagen gibt es aktuell (Stand: Sommer 2022) noch preiswerte Leseausgaben von Stine (z.B. Reclam, Insel, Fischer Klassik). Diese Ausgaben ergänzen den Text durch Informationen zu Autor und Werk, editorische Notizen und interpretierende Nachworte. Ihnen fehlen aber erläuternde und erklärende Hinweise auf Wort- oder Satzebene. Damit aber bleiben der heutigen Leserschaft die anspielungsreiche Sprache der agierenden Figuren wie auch der Erzählfigur, des Weiteren die topographischen Hinweise zu Handlungsorten weitgehend verschlossen. Und damit auch der sehr genaue und kunstvolle Bau des Romans. Aufgrund dessen muss man wohl die Editionslage im Preissegment der Taschenbücher als unbefriedigend bezeichnen. Deshalb darauf hinweisen zu müssen, man möge doch versuchen, antiquarisch auf die Ullstein-Taschenbuchausgabe zurückzugreifen, die wiederum auf Helmuth Nürnbergers Hanser-Ausgabe beruht, stimmt eher traurig.
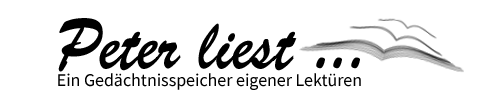

Das war wirklich eine tolle Analyse. Ich habe nie viel Fontane gelesen, erinnere mich kaum. Ich glaube, Wanderungen in der Mark Brandenburg oder so. Die Konstellationen aber, die hier erwähnt werden, lassen mich neugierig werden, auch diese Kamerafahrt. Wirklich gelungen! Vielen Dank, das war eine sehr anregende Lektüre. Viele Grüße!
Vielen Dank für die freundliche Rückmeldung. Fontane lohnt immer! Und Entschuldigung, dass ich mich so spät zurückmelde. Ich hatte Probleme mit der Anzeige von Kommentaren. Die scheinen aber jetzt behoben. Viele Grüße!
Als Brandenburgerin muss ich ja auch ein Fontane-Fan sein;)
Alles Liebe
Liara