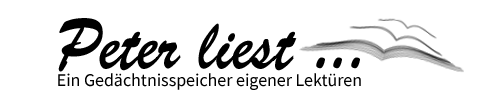Kehlmanns kurze Erzählung Du hättest gehen sollen hat, glaubt man der Paginierung, 95 Seiten. Der Text endet aber schon vier Seiten vorher mit der dritten Zeile: „Und dabei bin ich erst ganz am“. „Anfang“ wollte der Ich-Erzähler wohl noch in sein Notizbuch schreiben, ist aber nicht dazu gekommen, warum auch immer. Man ist erleichtert als Leser, dass die 92 Seiten nicht erst der Anfang waren, denn so viel künstliche Fadheit hätte man über einen längeren Zeitraum kaum ertragen. Wäre die Erzählung nicht so kurz gewesen, sie wäre eingegangen in die Liste der abgebrochenen Bücher, über die in ein paar Wochen, am Ende des Jahres, berichtet wird.
Die Handlung ist schnell skizziert: Ein Drehbuchautor hat sich mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in ein Ferienhaus in die Berge zurückgezogen, um zu entspannen, aber auch um das Drehbuch zum nächsten FIlmprojekt zu Ende schreiben. Er leidet allerdings an einer doch recht massiven Schreibblockade. Denn der Mann sieht sich dem Druck ausgesetzt, an seinen großen Erfolg „Allerbeste Freundin“ anknüpfen zu wollen; außerdem fühlt er sich zugleich von seiner Ehefrau Susanna in seiner Arbeit nicht gewürdigt. Er arbeite ohnehin nicht, er schaffe kein „Werk“. So lebt er die ganze Zeit mit einer unausgesprochenen Kränkung, die nicht dadurch geringer wird, dass sein Erfolgsdrehbuch die Kreditzinsen des Hauses bezahlt habe. Wie dem so ist, die ganzen familiären Spannung, dieses Unausgesprochene lässt man im Urlaub nicht zuhause, im Gegenteil es bricht sich Bahn, und das erst recht, wenn man so abgeschottet oberhalb eines Tales ein Haus bezogen hat, das nur über einen einzigen Zufahrtsweg zu erreichen ist.
Mit und in diesem Haus geschehen recht schnell merkwürdige Dinge. Flure verändern sich, Räume sind nicht mehr da, wo sie zuvor einmal waren, in den Fensters spiegeln sich Personen, die nicht anwesend sind. Der Ich-Erzähler wiederum generiert ab und an kein Spiegelbild; um das Haus ranken sich merkwürdige Gerüchte. Dass das Unheimliche sich aus dem ehemals Vertrauten speist, wissen wir spätestens seid Freuds Untersuchung Über das Unheimliche, dass uns das Setting der Geschichte erinnert an Stephen Kings Shining oder an David Lynchs Twin Peaks ist sicherlich nachvollziehbar. Das Problem ist nur: das Ganze ist nicht unheimlich. Was Kehlmann hier erzählt, ist bestenfalls ein Surrogat des Unheimlichen. Was auch immer er an Bedrohlichkeit, an Szenarien mit Angstpotential zu entwerfen versucht, es wirkt immer künstlich, aufgesetzt. Dieser Eindruck verstärkt sich dadurch, dass Kehlmann sich bemüht, mit dem Klischee zu spielen und es ironisch zu brechen. Das gelingt ihm aber nicht; eher im Gegenteil: er bedient es. So belastet er im Laufe der Handlung die Ehe mit einem Verhältnis, das seine Frau hat und das der Ich-Erzähler entdeckt, um am Ende der Frau das Bekenntnis abzuringen, ihr habe diese Affäre nie etwas bedeutet. Inhaltich vollkommen unnötig.
Auf erzähltechnischer Ebene zeigen sich analoge Schwierigkeiten. Wer Kehlmanns Prosa verfolgt, weiß, das sich das Spiegelmotiv durch sein Werk durchzieht. In den meisten seiner Texte spielt er damit souverän, bindet daran Perspektivbrüche und öffnet neue Sichtweisen auf Figuren und Konstellationen. Hier aber reitet er – man kann es kaum anders sagen – das Motiv tot. Jeder noch so belanglose Blick durch’s Fenster wird als Spiegelblick wahrgenommen, aber ebenso akribisch festgehalten, wenn es eben keine Spiegelung gibt. Sogar das Buchcover spielt noch mit dem Motiv. Das ist des Guten zu viel.
Klischees aber, erst recht wenn sie bestärkt statt in Frage gestellt werden, sind der Feind des Unheimlichen. Es entsteht ein Widerspruch zwischen Wirkungsabsicht und Darstellungweise. Deshalb funktioniert die Geschichte nicht und erzeugt einen Retortentext. Die Erzählung verlässt ihre Petrischale an keiner Stelle und kommt über einen Beitrag zu einer In-Vitro-Literatur nicht hinaus. Wen Kehlmanns Prosa ohnehin kalt lässt, wird das mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nehmen; wer aber die Arbeiten des Autors mit Wohlwollen und Interesse verfolgt, den wird es schmerzen.
Daniel Kehlmann: Du hättest gehen sollen. Erzählung. – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag 2016 (15.- €)