Während sich am Ende des letzten Jahres der dritte Teil seines Erinnerungsprojekts „Alle Toten fliegen hoch“ mit dem Titel Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke in den oberen Plätzen der verschiedenen Bestsellerlisten etablierte, habe ich Joachim Meyerhoffs zweiten Roman dieses Zyklusses gelesen. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war erschien 2013 und kam im letzten Jahr im Vorfeld des neuen Romans als Taschenbuch auf den Markt. Mir war Autor und Roman bis dahin unbekannt; ich wurde über die Nominiertenliste für den Euregio Literaturpreis 2016 darauf aufmerksam. Die Blogbeiträge dieses Jahres mit Meyerhoffs Roman zu beginnen, ist ein glücklicher und schöner Zufall, denn die Lektüre hat sich uneingeschränkt gelohnt.
Dabei begann sie mit einem Lesefehler, den ich ein ganzen Stück weit mit in den Roman hineintrug. Ich hatte das Adverb „nie“ im Titel schlichtweg überlesen oder unbewusst unterschlagen und fragte mich zunehmend, wo sich denn das Bewahrenswerte verstecke, das gute Vergangene, das es im Zuge der Erinnerung herbeizuschreiben gelte. Bis ich bemerkte, dass ich etwas übersehen hatte.
Ohne Zweifel, der Titel ist Programm. Der Erzähler begibt sich auf den Weg in seine Kindheit und Jugend, um zu finden, was bewahrenswert scheint. Bewahrenswert ist aber nicht allein das vergangene Reale, sondern ebenso, wenn nicht gar mehr, das vergangene Mögliche. Deutlich wird das gleich im Eingangskapitel des Romans. Der Ich-Erzähler darf an seinem siebten Geburtstag zum ersten Mal alleine zur Schule gehen. Dieser Weg hat für ihn etwas Befreiendes, er nimmt sich als ‚Einzelnen‘ wahr und entdeckt eine Welt, die ihm neu erscheint. Zu dieser Welt gehört ein Toter, den der Junge in einer Schrebergartenanlage entdeckt. Er läuft zur Schule, erzählt, was er gesehen hat, aber zunächst glaubt ihm niemand. Man ist eher misstrauisch, weil man den Jungen als phantasiegeleitetes Kind einschätzt. Aber als er anfängt, Dinge hinzu zu erfinden, geht man seinen Hinweisen nach und findet auch den Toten. Dieses Ausfabulieren dessen, was der Junge als Wirklichkeit wahrnimmt, wird aufgrund dieser Erfahrung zum poetologischen Prinzip des Erinnerns und des Schreibens.
Nie werde ich diesen Augenblick vergessen. Ich hatte etwas erfunden, das wahr war. […] Wie ein archäologisches Instrument hatte die Lüge ein eingeschlossenes Detail herausgekratzt und den Tiefen des Gedächtnisses wieder entrissen.
Für mich war das eine unfassbar befreiende Erkenntnis: Erfinden heißt Erinnern.
Damit erinnert Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war an einen gewichtigen Vorläufer. „Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen“. So zitiert Christa Wolf in ihrem 1976 erschienenen Roman Kindheitsmuster William Faulkner. Ihr Roman über die eigene Kindheit im Nationalsozialismus und das Erinnern daran kreist um die Frage, wie „wir geworden sind wie wir heute sind“. Vom literarischen Gewicht her zögere ich nicht, Meyerhoffs Roman mit dem Christa Wolfs zu vergleichen, von der Konzeption her unterscheidet er sich davon grundsätzlich. Denn Meyerhoff geht es im Gegensatz zur großen Vorläuferin nicht um das ‚Muster‘, das sich im Ich des Erzählers etabliert, sondern um das Individuelle des Jungen, den er zeigt und begleitet. Das Erzähler-Ich wird nicht zum Prototypen eines kollektiven „wir“, das die Wucht der Geschichte in seinem Verhalten und Denken prägt, sondern bleibt bei dem einzelnen Ich und seiner Lebensgeschichte.
Dabei ist die Lebenssituation, in der der Heranwachsende groß wird, skurril genug. Denn er wächst auf in der jugendpsychiatrischen Heilanstalt in Schleswig-Hesterfeld. Sein Vater ist der Leiter dieser Klinik und wohnt mit seiner Familie mitten auf dem Gelände. Und das darf man wörtlich nehmen. Das gesamte Klinikgelände scheint architektonisch so angelegt zu sein, dass sich alle anderen, medizinischen Gebäude um das Wohnhaus und den sich daran unmittelbar anschließenden Park gruppieren. Umgeben ist das gesamte Areal von einer Mauer. Ein Hortus conclusus der ganz besonderen Art. Der Junge wird in einer Welt sozialisiert, in der die menschliche Normabweichung das Normale ist. Er ist umgeben von psychisch und physisch Kranken, von Menschen, die sich außerhalb dieser Mauern nicht zurecht finden würden, die in ihrer räumlichen Abgeschlossenheit gesellschaftliche Ausgegrenztheit nicht erfahren müssen. Das allerdings um den Preis der Isolation. Meyerhoff gelingt es, diese Menschen mit großer Warmherzigkeit zu schildern. So entstellt ihre Körper, so bizarr ihr Verhalten, werden sie doch nie als Irre oder gar als Monster wahrgenommen. Ihm gelingt es, sie in ihrer Individualität zu zeigen und bewahrt ihnen so ihre Würde. Erst am Ende des Romans wird in Zweifel gezogen, ob der Blick, den der literarische Text auf diese Kranken wirft, tatsächlich den Umgang mit ihnen abbildet, der der Klinik über die Jahre der Kindheit und Jugend eigen war.
Konnte das sein? Dass es für alle besser geworden war außer für mich? Da wurde mir klar, dass ich den Verlust einer Welt betrauerte, an deren Verschwinden nichts Trauriges war. Meine Sentimentalität galt einem weltabgewandten, höllischen Ort. Gott sei Dank war diese überfüllte Anstalt verschwunden!
Doch zunächst und für lange Zeit ist sie da und bestimmt das Leben aller, die dort sind. Episodenhaft und nur im Groben linear-chronologisch erzählt Joachim Meyerhoff die Geschichte dieser Kindheit und Jugend. Manches von dem, was er erzählt, ist ausgesprochen komisch. Wenn zum Beispiel der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg die Klinik besucht und der Auftritt eines der Kranken seitens der Sicherheitsbeamten zu der Annahme führt, der prominente Politiker geriete in Gefahr, dann kann man sich das Lachen kaum verkneifen. Was nämlich folgt, ist Slapstick, allerdings ein guter.
Doch zugleich ist der Textur des Komischen auch immer ein Faden Grau eingewebt. Im Laufe des Romans werden diese Fäden mehr und sie werden immer grauer.
Das liegt nicht zuletzt an der Familiengeschichte. Die fünfköpfige Familie mit Hund erscheint zunächst als ausgesproch gut funktionierendes Kollektiv, in dem jeder in seiner Eigenart angenommen und akzeptiert wird. Doch das Bild bekommt im Laufe des Romans zunehmend Risse. Für den Ich-Erzähler steht dabei immer der Vater im Mittelpunkt. Ja, man kann das Buch in weiten Passagen durchaus als Vaterroman bezeichnen. Doch die Bewunderung und die Liebe, die das Kind dem Vater und der Vater dem Kind entgegenbringt, wird im Laufe des Adoleszenz immer stärker belastet. Ja, dieser Vater ist schon ein ebenso imposanter wie merkwürdiger Mann. Jemand, der groß ist und ausgesprochen dick, wenn nicht gar fett. Jemand, der sich im Umgang mit seinen Patienten leichter zu tun scheint als mit den Menschen außerhalb der Klinik, der deshalb seinen Geburtstag lieber mit den Anstaltsinsassen feiert als mit anderen Menschen. Jemand, der ausgesprochen belesen ist, vielfältige intellektuelle Interessen hat, aber im Alltagsleben ein Versager bleibt. Was er für die Familie theoretisch entwirft, setzt die Mutter um – oder badet es aus. Bis es reicht.
Auch der Ich-Erzähler hat ein Handicap, eines, das er schwer in den Griff bekommt. Heute würde man es wohl als AD(H)S bezeichnen, heute würde man das Kind wahrscheinlich mit Ritalin behandeln, vor seiner Zeit wäre es vielleicht als Patient in der väterlichen Klinik gelandet. Jetzt muss man seine Tobsuchtsanfälle ertragen, deren Heftigkeit er als Folge ihrer vergeblichen Unterdrückung beschreibt, die sich schließlich endlädt. Als Leser kann man zwar Verständnis aufbringen für den Jungen, nicht zuletzt aufgrund der überheblichen Spötteleien und Drangsalierungen durch die beiden älteren Brüder, die er oft ertragen muss. Aber in dem Moment, in dem er von den Wutattacken übermannt wird, steht man im Kreis derjenigen, die den Jungen hilflos betrachten und sich Fragen stellen nach den Ursachen. Sie werden nicht beantwortet. Aber es gibt eine Erzählpassage, die die Verstörung potenziert, und die in meiner Lektüre die Stimmung des Romans endgültig ins dunkelgrau Traurige kippen lässt.
Vor meinen Augen zeigte ein wahrer Wut-Großmeister seine Kunst: Meine Mutter saß auf dem braunen Teppichboden und zerfetzte Zeitungen. Noch nie hatte ich ihre geschminkten Lippen so rot gesehen, noch nie ihre gefärbten Haare so schwarz. […] Dabei brüllte sie: „Das Schwein soll endlich abhauen!“ Diese aus den Tiefen ihres Kummers herausbrechende Stimme war mir völlig unbekannt: rau und tief. Noch nie hatte ich mich vor meiner Mutter gefürchtet. Doch diese von unsichtbaren Furien gebeutetelte Frau, dieses Zeitungen zerfetzende, brüllende Muttermonster jagte mir einen gehörigen Schrecken ein.
Noch beklemmender wird der Wutausbruch, dessen Zeuge die Kinder werden, durch den Umstand, dass der Vater lange Zeit scheinbar vollkommen ungerührt daneben steht und seiner Ehefrau zuschaut. Spät erst interveniert er. Im Rückblick reagiert der Ich-Erzähler verständnislos auf sein eigenes damaliges Verhalten. Denn er schlägt sich auf die Seite des Vaters.
Ich sah meinen Vater an und tat etwas, das mich noch am selben Abend im Bett verwundern und noch Jahre später umtreiben sollte: Ich sah ihn an und zuckte ganz leicht mit den Schultern. Es war eine winzige, aber doch eindeutige Geste. Wie konnte ich nur? Ich schlug mich mit diesem Schulterzucken auf seine Seite und machte mich zu seinem Verbündeten.
Hier spätestens beginnt das Auseinanderfallen der Familie. Der Ich-Erzähler dokumentiert fortan hauptsächlich die Schicksalsschläge und Zerwürfnisse: die Entdeckung, dass der bewunderte Vater fremd geht, den Unfalltod des mittleren Bruders, den Tod des Familienhundes, das Zerbrechen der Ehe und schließlich den Krebstod des Vaters, der den einst stattlichen Mann zur erbärmlichen Kreatur macht. Das Sterben des Vaters zeitigt noch einmal merkwürdige, auch dem Ich-Erzähler unverständlich bleibende Verhaltensweisen. Nicht nur, dass alle Überlebenden noch einmal zusammenkommen, nein, auch die Mutter kehrt noch einmal zu ihrem Mann zurück und pflegt ihn. Was die Familie prägt, scheint über alle Verletzungen und Zerwürfnisse hinaus etwas zu sein wie wechselseitige Verantwortlichkeit und ein schwer zu fassendes Gefühl von Bindung. Wer in diesem Zusammenhang an das berühmte kritische Diktum von Karl Kraus denkt, das Wort „Familienbande“ habe manchmal einen „Beigeschmack von Wahrheit“, der sieht sich aber hier getäuscht. Joachim Meyerhoff hat einen Roman geschrieben, in dem es nicht um Bewältigung von nicht Bewältigbaren oder um Abrechnung geht. Insofern ist die Familie auch keine Bande, aber sie hat Banden. Sich derer zu vergewissern, ist ein großes Projekt, dem sich Meyerhoff eindrucksvoll stellt.
Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war. Roman. – Köln: Verlag Kiepenheuer & Witsch 2015 (KiWi. 1393). (9,99 €)
Nachlese
Weitere Blog-Besprechung zu Joachim Meyerhoffs Wann wir es endlich wieder so, wie es nie war bei Literaturen und bei buchpost.
Im April 2016 erhielt Joachim Meyerhoff für den Roman den Euregio-Schüler-Literaturpreis 2016.
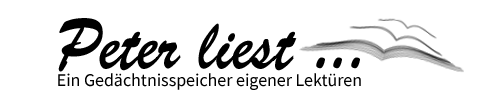

Pingback: Joachim Meyerhoff: Wann wird es endlich so, wie es nie war (2013) – buchpost
Pingback: Emmanuelle Pirotte: Heute leben wir - Peter liest ...