Knecht Ruprecht
| Von drauß’ vom Walde komm ich her; Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr! Allüberall auf den Tannenspitzen Sah ich goldene Lichtlein sitzen; Und droben aus dem Himmelstor Sah mit großen Augen das Christkind hervor, Und wie ich so strolcht’ durch den finstern Tann, Da rief’s mich mit heller Stimme an: „Knecht Ruprecht“, rief es, „alter Gesell, Hebe die Beine und spute dich schnell! Die Kerzen fangen zu brennen an, Das Himmelstor ist aufgetan, Alt’ und Junge sollen nun Von der Jagd des Lebens einmal ruhn; Und morgen flieg’ ich hinab zur Erden; Denn es soll wieder Weihnachten werden!“ Ich sprach: „O lieber Herre Christ, Meine Reise fast zu Ende ist; |
Ich soll nur noch in diese Stadt, Wo’s eitel gute Kinder hat.“ – „Hast denn das Säcklein auch bei dir?“ Ich sprach: „Das Säcklein das ist hier: Denn Äpfel, Nuß und Mandelkern Fressen fromme Kinder gern.“ – „Hast denn die Rute auch bei dir?“ Ich sprach: „Die Rute, die ist hier: Doch für die Kinder nur, die schlechten, Die trifft sie auf den Teil, den rechten.“ Christkindlein sprach: „So ist es recht; So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“ Von drauß’ vom Walde komm ich her; Ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr! Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find’! Sind’s gute Kind’, sind’s böse Kind’? |
| Theodor Storm: Sämtliche Werke in vier Bänden. Hrsg. von Karl Ernst Laage und Dieter Lohmeier. Band 1. – Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag 1987, S. 76f. | |
Läge mir das Wetten, so wäre ich wohl fast jede Wette eingegangen, hätte jemand gezweifelt, ob ich Theodor Storms Gedicht Knecht Ruprecht auswendig vortragen könne. Ich hätte sie, die Wette, rundum vergeigt. Denn als ich mir die Textvorlage für den Weihnachtsbeitrag, den ich schreiben wollte, anschaute, traute ich den Augen nicht, glaubte zunächst, mich verlesen zuhaben, sah, dass es nicht so war, zweifelte die Zuverlässigkeit der Werkausgabe an, kontrollierte und verglich, so weit es ging, mit anderen Textsammlungen und stellte schließlich konsterniert fest: Da steht tatsächlich: „Fressen fromme Kinder gern.“ Fromme Kinder „fressen“!?
Okay, es hat, so dachte ich dann, seit Mitte des letzten Jahrhunderts eine semantische Verschiebung gegeben! Nur, weder der alte „Adelung“ noch das „Grimmsche Wörterbuch“ bestätigen die Vermutung. Es scheint vielmehr, als habe das Verb „fressen“ auch schon im 19. Jahrhundert hauptsächlich die Nahrungsaufnahme der Tiere oder aber ein ungebührliches Essverhalten bezeichnet. Also, was bleibt uns übrig, nehmen wir sie erst einmal hin, die fressenden Kinder, und reihen sie ein in die Fragen, die das Gedicht aufwirft, aber nicht ausdrücklich stellt.
Seit Kindertagen verbinde ich mit Storms Gedicht das Nikolausfest, nicht Weihnachten, und zwar zeitweise so sehr, dass für mich die beiden Brauchtumsfiguren irgendwann miteinander verschmolzen. Der, der hier im Gedicht spricht, war in meiner Wahrnehmung der Nikolaus, und das, obwohl ich Knecht Ruprecht als Nikolausbegleiter durchaus kannte. Aber die Bildhaftigkeit des Gedichts war mächtiger als die Begegnung mit den Figuren auf diversen Nikolausfeiern im Kindergarten und später in der Schule. Dass Knecht Ruprecht im 19. Jahrhundert in manchen Regionen Deutschlands den Nikolaus verdrängt und eine durchaus an archaischeren Traditionen anknüpfende Eigengestalt gewonnen hatte, wusste ich natürlich nicht. Genau daran aber scheint Storm mit seinem Gedicht anzuknüpfen. Mag sein, dass daher auch die befremdliche Vorstellung von den Süßigkeiten fressenden Kindern herrührt.
Ohnehin erscheint mir heute das Gedicht voller Merkwürdigkeiten und Befremdlichkeiten, die mich als Kind allesamt nicht interessiert hatten, die ich schlicht ignorierte. Der, der uns da entgegentritt und anspricht, ist doch zunächst einmal ein ziemlich grobschlächtiger Zeitgenosse. Offensichtlich ein Naturbursche, der gerne den dunklen Wald durchstreift, der, ebenso ganz offensichtlich, na sagen wir: fragwürdige Erziehungsvorstellungen vertritt. Züchtigung und Belohnung sind nicht nur die zentralen, sondern offenbar die einzigen Erziehungsstrategien, die er kennt. Tertium non datur! Ein ziemlich autoritätsbeflissener Mensch ist er obendrein. Denn er zeigt sich als recht willfähriger Exekutant von Vorgaben, die er nicht hinterfragt; ein Erfüllungsgehilfe quasi. Derlei Typen kennen wir. Das Besondere an ihm ist dabei nur: er gehorcht einem Kind, dem Christkind.
Die Tradition des Christkinds geht wohl auf Martin Luther zurück, der mit der Ablehnung der Heiligenverehrung auch gleich den Nikolaus als Kinderbeschenker entsorgte und an dessen Statt die Vorstellung von Christkind in die Welt setzte und etablierte. Diese Idee vom Kind als Heilsbringer hat sich dann in den folgenden Jahrhunderten offenbar so sehr festgesetzt, dass Weihnachten dem eigentlich höchsten theologischen Fest Ostern im Bewusstsein einer christlich geprägten Bevölkerung den Rang abgelaufen hat. Was sicherlich auch an der Bildlogik der Figur selber liegt, lässt sich mit einem Kind die Vorstellung vom Todesüberwinder ungleich schwerer verbinden als mit einem erwachsenen und von seinen Widersachern geschundenen Mann.
Dafür aber sind andere Zuschreibungen möglich, und die finden wir auch in Knecht Ruprecht. Denn warum will dieses Christkind „hinab zur Erden“? Es gibt die Antwort darauf selbst: „Alt‘ und Junge sollen nun / Von der Last des Lebens einmal ruhn“. Weihnachten also nicht als Erlöser- sondern als Entschleunigungsfest. Das rückt uns doch das wahrscheinlich 1861 entstandene Gedicht sehr nah.
Nur die Idylle mag nicht greifen. Immer wieder dieses Strafen und Belohnen – und eine gewisse Ungeklärtheit, die das Gedicht mit sich bringt. Bis heute verstehe ich den vorletzten Vers nicht, der vielleicht auch deshalb oftmals Anlass für Versprecher beim Vortragen geliefert hat. Wer der Adressat der abschließenden Frage ist, schien mir irgendwann plausibel. Offenbar fragt Knecht Ruprecht anwesende Erwachsene, welche Gehorsamsqualitäten anwesende Kinder gezeigt hätten. Leichter vorzustellen ist dieser Zusammenhang, wenn man darauf achtet, wie das Gedicht in die Erzählung Unter dem Tannenbaum (1862) eingebettet ist, in der es erstmals veröffentlichte wurde. Hier erinnern sich Vater und Sohn an das letzte Weihnachten vor der Flucht ins Exil (ohne Zweifel eine autobiographische Replik), in der sich beim Auftritt dieses Knecht Ruprecht der Vater für die Rechtschaffenheit seines Sohnes verbürgt und damit Bestrafung ausschließt. Aber worauf bezieht sich das „hierinnen“ des Strafe- und Geschenkebringers: „Nun sprecht, wie ich’s hierinnen find‘!“ – Worinnen denn? In einer Art Dokumentenmappe, die die Taten der Kinder verzeichnet, so etwas wie dem goldenen Buch des Nikolaus? Dann müsste man aber nicht nach Gut und Böse fragen; es stünde ja in dem Buch. Oder weist Knecht Ruprecht mit einer Geste auf sein eigenes Inneres in dem Moment, in dem er den Satz ausspricht? Aber als innerlichkeitsbeflissener Mensch ist der Grobschlacht bisher nicht aufgetreten.
Was bleibt, sind die Fragen. Mehr Fragen als vor einem knappen halben Jahrhundert, als ich das Gedicht kennen und – ja: lieben lernen durfte. Es ist und bleibt mir eine Kindheitserinnerung allemal, zugleich ein Zeugnis einer tiefst bürgerlichen Vorstellung von Weihnachten in ihrer ganzen Ambivalenz, die zu bewahren und zu hinterfragen eins ist.
Ich wünsche allen Lesern meines Blogs ein frohes Weihnachtsfest und für das bald kommende Jahr alles erdenklich Gute!
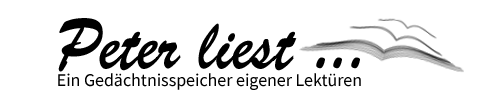

Vielen Dank für die persönliche Auslegung dieses Klassikers! Mir war zum Beispiel überhaupt nicht klar, dass das Gedicht, das mich auch in Kindertagen verzückte, von Theodor Storm ist.
Ich meine, es war auch das Gedicht, das ich in Grundschultagen vor Publikum -vermutlich auszugsweise – aufsagen sollte und ich mich nicht traute und alle Engelszungen meiner Lehrerin nichts nutzten und jemand anderes bei der Weihnachtsfeier erste Erfahrungen mit dem Vortragen vor Publikum machen durfte.
Nunja. Ich wünsche Dir auch ein paar geruhsame Festtage und alles Gute im neuen Jahr!
Das ist tatsächlich eine merkwürdige Stelle. Dem Ruprecht als rauen Gesellen hat man manchorts ja nachgesagt, dass er selbst Kinder frisst, vielleicht rührt seine Wortwahl eben auch daher? Zur Not könnte man natürlich auch noch die Herausgeber der Storm-Ausgabe anschreiben. Aber ob die schlauer sind? Ja, auch Dir schöne Feiertage! – Und danke für die schöne Textanalyse!
Gruß Wolfgang
Pingback: Joachim Ringelnatz: Vorfreude auf Weihnachten - Peter liest ...