Botho von Rienäcker, Diederich Heßling, Hans Castorp, Hans Schnier, Anselm Kristlein, Gesine Cresspahl oder auch Michael Berg – man muss diese Namen nur langsam aussprechen, dabei ein wenig den eigenen Gesichtsmuskeln nachspüren und schon entsteht eine Vorstellung, wie jemand aussieht, der so heißt. Mit dem Namen entsteht ein Bild, das da ist, bevor man im Roman etwas über die Figur liest, verfolgt, wie sie sich entwickelt, was mit ihr geschieht. Mag sein, dass sich die Vorstellung hier und da noch korrigiert, aber es ist immer eine Korrektur an einem Gesicht, einer Statur, an Bewegungen, typischen Gesten und Mimik, die mit dem Namen schon da waren. So ist es auch mit der Hauptfigur aus Jonas Lüschers jüngstem Roman.
Richard Kraft – kann man sich darunter einen anderen als einen kantigen Typ vorstellen? Einen, der sich durchzusetzen versteht, seinen Weg geht, der selbst im heißesten Sommer selten in Shorts und T-Shirt durch die Gegend läuft, der, wenn es seine berufliche Tätigkeit erlaubt, Jeans und Sakko trägt, nach außen leger, allen zeigend, dass er ein Macher ist, einer, der Erfolg hat, nicht weil er dem Mainstream folgt, sondern weil er es kann. Einer, der tatsächlich das Zeug hat, dass ein ganzer Roman nach seinem Nachnamen betitelt ist. Nomen est omen, zumindest beinahe.
Dieser Kraft, schließlich Rhetorik-Professor in Tübingen, Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Walter Jens, kleiner geht’s nicht, ist aber durchaus auch ein verletzlicher Charakter, einer, der dem Leser in den Momenten seiner Hilflosigkeit sogar so etwas wie Sympathie abringen kann. Er ist zudem ein Melancholiker, hat allerdings eben die ungünstige Fähigkeit, „aus einer leisen Melancholie eine pathosgesättigte Katharsis zu züchten“, wie es ziemlich zu Anfang des Romans in einer pointierten Formulierung des an pointierten Formulierungen reichen Romans heißt. Da ist Kraft auf dem Weg in die Vereinigten Staaten und beschäftigt mit den Abschiedsworten seiner zweiten Frau Heike, die ihm ein gewaltiges Gepäck mitgegeben hat: „Geh, gewinne, bring uns das Geld nach Hause, damit wir alle wieder unsere Freiheit haben, hatte sie gesagt.“ Das war ihre sprachgewordene und durchaus wörtlich zu nehmende Mitgift beim Abschied. Sie will die Trennung, eine Trennung, die man sich aber leisten können muss. Genau das ist der Haken, Professorengehalt hin oder her. Denn da sind auch noch die Unterhaltszahlungen an Frau und Sohn aus erster Ehe in solch großzügiger Verbindlichkeit, dass man darin nichts Gutherziges erkennen kann, sondern nur eine Mischung aus Blasiertheit – man kann es sich leisten – und Wirklichkeitsverdrängung – man kann es sich eben dauerhaft nicht leisten. Und nun das Ganze zu wiederholen, angesichts zweier unterhaltsberechtigter Töchter noch zu steigern …
Da kommt die Ausschreibung einer philosophischen Preisfrage gerade recht: Theodicy and Technodicy: Optimism for a Young Millenium. Why whatever is, is right and why we still can improve it? Ausgeschrieben von einem New Economy-Mogul aus dem Silicon Valley, Tobias Erkner, der dem Gewinner 1 Million US-Doller anbietet. Schaut man genau hin, so ist die Preisfrage so absurd wie die Höhe des möglichen Gewinns und das vorgegebene Szenario. Ermittelt werden soll der Preisträger in einem Vortrag, der genau 18 Minuten dauern soll, nicht 17, nicht 19 Minuten. Je weiter man im Roman fortschreitet, je eindrücklicher man erfährt, wie sich Kraft während seines Aufenthalts in Stanford abmüht, um einen Wettbewerbsbeitrag halten zu können, desto absurder erscheint das Denken, aus dem diese Preisfrage erwachsen ist. Je mehr man über diesen Kraft erfährt, desto deutlicher wird auch, dass er nicht Protagonist eines solchen Denkens ist, sondern dessen Produkt.
In geschickt montierten Rückblenden holt der Erzähler die weithin akademische Lebensgeschichte des Richard Kraft immer mehr in die Standford-Gegenwart der Vorbereitung auf den Wettbewerb hinein, eine Vorbereitung der ganz eigenen Art. Es spricht für Lüschers literarisches Gestaltungsvermögen, dass er entgegen einem offensichtlichen Trend keine hunderte von Seiten braucht, um Krafts Denken aus dem Geist des in den 1980er-Jahren immer erstarkenderen Neoliberalismus deutlich zu machen. Aber es ist nicht nur eine Denkweise, die sich Kraft, dieser Anhänger von Margret Thatcher und Ronald Reagan, aus opportunistischen Gründen zu eigen macht, es ist auch lange Zeit durchaus eine Erfolgsgeschichte. Martin Walser hat in seinem Roman Der Lebenslauf der Liebe (2001) die Vorstellung vom „Unglücksglück“ entwickelt und damit einen Begriff geprägt, der ganz und gar existenzieller ist als die landläufige Redewendung vom Glück im Unglück. Etwas umgekehrt Vergleichbares trifft auf Richard Kraft zu. Schaut man auf seinen Werdegang, so stellt sich ein Begriff ein wie das „Glücksunglück“ als Beschreibung eines Lebensfortgangs, der den Erfolg nach außen bringt und die intellektuelle Erfüllung wirklich macht, ohne zu merken, dass es genau dieses Glück ist, das dem Unglück den Weg pflastert.
Auf diesen Weg begleitet der Leser Richard Kraft in Stanford ebenso wie in den Rückblenden und erlebt ihn in einer Reihe von Situationen, die ihn als komische Gestalt darstellen, die ihn auch lächerlich machen. Dem Erzähler ist es offenbar ein Vergnügen, ihn so zu zeigen, und er scheut sich nicht, in Formulierungen wie „unser Kraft“ oder in direkten Leseranreden, die im „wir“ die Grenze zwischen Augenzwinkern und Kumpanei mit dem Leser verwischen, seinem Spott über diese ja auch traurige Gestalt ziemlich freien Lauf zu lassen. Lüscher versteht es dabei wie in seiner Debütnovelle Frühling der Barbaren (2013) Szenen zu entwerfen, die schreiend komisch sind und die ganze Farce deutlich machen. Was für den Roman weniger einnimmt als für die Novelle, ist die weitreichende Vorhersehbarkeit der Entwicklung. Es ist recht schnell klar, Kraft ist in der Lebensfalle, seine intellektuellen Versuche der Selbstrechtfertigung sind ins Leere gelaufen. Man fragt sich schließlich nur noch: Wie kommt der Roman zu seinem Ende? Mit erneutem Blick auf Frühling der Barbaren drängt sich der Eindruck auf, Lüscher habe durchaus ein Faible für den großen Showdown. Denn auf solche Weise lässt er seinen Erzähler zugreifen und ihn genüsslich zelebrieren. Ob man sich am Ende, wenn die Glocke des Hoover-Turms läutet, dann doch wundert, sollte jeder selbst entscheiden.
Jonas Lüscher: Kraft. Roman. – München: Verlag C.H. Beck 2017 (19.95 €).
Nachgelesenes
Jonas Lüschers Roman Kraft ist in zahreichen Feuilletons, Kultursendungen und Blogs vorgestellt worden. Er stand im Februar 2017 auf der SWR-Bestenliste auf Platz Eins. Besonders aufmerksam machen möchte ich jedoch auf den sehr schönen Beitrag zum Roman auf dem „grauen Sofa“.
Bildquelle für die Montage des Beitragsbildes:
Foto des Standford University Campus von Frank Schulenburg – Own work, CC BY-SA 4.0, Link
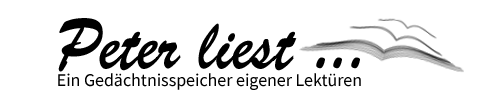

Der große Showdown, die Farce: Mir war das schon bei „Frühling der Barbaren“ eine Spur zu dick aufgetragen, zu sehr „Kino“. Schon ein intelligenter Erzähler, aber er büchst für meinen Geschmack zu sehr in diese knalligen Bilder aus. Dennoch werde ich Kraft bei Gelegenheit lesen. Einige sind ja geradezu euphorisch, wenn sie über diesen Roman sprechen, deine Rezension finde ich fein in ihrer Differenzierung.
Danke für deine freundliche Rückmeldung.
Ja, in den Chor der uneingeschränkt Begeisterten kann ich nicht einstimmen. Der Roman macht allein schon auf sprachlicher Ebene, worauf ich vielleicht zu wenig eingegangen bin, große Freude. Auch die gewaltige Fallhöhe zwischen intellektuellem Diskurs und Slapstick hat mich fast immer überzeugt. Aber es ist viel zu schnell klar, dass diese Figur keine Chance hat, aus seinen Selbstverstrickungen herauszukommen, so dass man sich als Leser nur noch die Frage stellt: Wie kommt der Roman aus dieser Erzählkonstruktion heraus? Das geschieht mit großem Effekt, überzeugt mich aber nicht.
Pingback: Deutscher Buchpreis 2017 - Die Longlist: Eine Rezensionsübersicht