I
Lesen weckt Vorstellungen, erzeugt Assoziationen und Gedanken, die dann auch wegvagabundieren können vom Gelesenen, sich in ein freies Feld bewegen der eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten. Gleichgültig, ob sie nun haltbar sind oder nicht. Im Schreiben aber über das Gelesene muss das Herumstreunen wieder gebändigt werden, damit das Geschriebene lesbar bleibt. Das geschieht mit unterschiedlicher Entschiedenheit und Stärke. Je mehr der eigene Text Objektivierbarkeit beansprucht oder beanspruchen muss, desto stärker wird die Bändigung des Assoziativen sein. Aufgrund dessen unterliegt der literaturkritische Text im Feuilleton in der Regel auch stärkeren Restriktionen als der Beitrag im Literaturblog. Letzterer erlaubt Aussagen, die im Feuilleton der redaktionellen Arbeit am Text zum Opfer fallen würden, je nach Notwendigkeit sogar müssten. Die hier zum No-Go erhobene, dort mit Selbstverständlichkeit vertretene, manchmal mit Verve verteidigte Option, im Beitrag „ich“ zu sagen, ist nur ein Beispiel für diesen Unterschied. Die oben angesprochenen vagabundierenden Gedanken, Assoziationen und Vorstellungsbilder markieren den Unterschied noch deutlicher.
Im Feuilleton geht es selten um die Prozesse, die beim Lesen eines Gedichts, einer Erzählung, eines Romans in Gang gekommen sind. Es gebt um das Leseergebnis, das in ein Qualitätsurteil mündet. Deshalb fällt es eben auch schwer, Gedanken festzuhalten, die ins Leere laufen, dem Buch, das vorgestellt wird, von der Sache her nicht gerecht werden, während der Blog derlei erlaubt. Bei allem Eigenwert des Feuilletons, den es grundsätzlich zu verteidigen gilt, macht dieser Spielraum den Reiz des Literaturblogs aus.
II
Zwei Assoziationen stiegen auf und entwickelten sich beim Lesen von Ralf Rothmanns neuem Roman Der Gott jenes Sommers. Zunächst drängte sich die Erinnerung an eine Äußerung Theodor Fontanes zu seinem Roman „Der Stechlin“ (1898) ins Gedächtnis. Am Ende sterbe ein Alter und zwei Junge heiraten, war, hier sinngemäß wiedergegeben, sein Kommentar zu dem Hinweis, vielleicht war es auch eine kritisch gemeinte Bemerkung, der Roman sei handlungsarm. Gestorben wird auch in Rothmanns Der Gott jenes Sommers, und zwar reichlich, aber nicht am Ende; und geheiratet wird gar nicht. Inhaltlich läuft die Assoziation also vollends ins Leere. Handlungsarm ist der Roman aber schon, wenn auch auf andere Weise.
Zeitlich ist er eingebettet in die Endphase des Zweiten Weltkriegs und umfasst, grob gesagt, den Zeitraum vom letzten Jahresdrittel 1944 bis zum Frühjahr, wahrscheinlich Mai 1945, also kurz nach Kriegsende. Draußen auf dem Land, dem Kieler Hinterland, wohin die zwölfjährige Louisa Norff mit ihrer Mutter und der älteren Schwester Sibylle evakuiert ist, wartet man eigentlich nur noch auf das Ende des Krieges. Hilflos und auf eine doppelte Weise unberührt erlebt man die regelmäßigen Luftangriffe auf Kiel. Hilflos, weil die Alliierten mittlerweile weithin ungehindert im Luftraum operieren können; unberührt, weil das Landgut, auf dem man untergekommen ist und das sich immer mehr mit Flüchtlingen füllt, offensichtlich kein militärisch relevantes Ziel darstellt und verschont bleibt, unberührt aber auch, weil die Ereignisse nur müde emotionale oder zynische Reaktionen zur Folge haben, zumindest bei den Erwachsenen. Zu gewährleisten ist nicht das Leben. sondern das Überleben. So verhält man sich.
Vollkommen anders und erst recht aus anderen Gründen also ist der Roman handlungsarm. Es ist das unbestimmte Warten auf das Ende, sei es als Untergang, sei es als auf sich warten lassender Neubeginn, der die geschilderten Verhältnisse drückend starr erscheinen lassen. Bewegung, Regung geht ab und an nur noch von den Kindern und Jugendlichen aus.
III
Der andere Gedanke: Kindheitsmuster? Steht Rothmann in der Tradition von Christa Wolfs gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1976? Hier wie dort geht es um ein Mädchen im Nationalsozialismus. Grosso modo sind sie gleich alt; außerdem verbindet sie ihre Begeisterung für, ja Liebe zur Literatur. Vergleichbar sind – weithin – auch ihre Endkriegserfahrungen. Und dennoch: Nein, auch dieser Gedanke trägt nicht. Christa Wolfs Roman umfasst einen deutlich größeren Zeitraum, nicht nur die Kriegsendjahre und den Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Nelly, Hauptfigur und Alter Ego der Autorin, zeigt sich von den Angeboten des NS-Regimes an die jungen Menschen durchaus fasziniert und angezogen, eine Haltung, vor der Louisa gefeit ist.
Vor allem aber ist die Machart eine ganz andere. Die Autorin unterzieht die sich im Erzählen niederschlagende Erinnerung einer permanenten Metareflexion. Das macht das Erzählkonstrukt auf den ersten Blick ambitionierter. Rothmann hingegen bleibt immer bei seinen Figuren, zuallererst bei Louisa. Der meistens personale, manchmal auch auktoriale Erzähler enthält sich distanzierender Wertungen, während Wolf aus der Perspektive derjenigen erzählt, die um die Verbrechen des Nationalsozialismus weiß. Sie ist sich bewusst, dass das Geleitetsein ihrer Hauptfigur ein moralisches Fehlgeleitetsein war, das man nun mit trägt in den eigenen Klamotten und nicht ablegen kann. Von solch steuernden und ab und an zum bevormundenden Moralisieren neigenden Perspektiven ist Rothmanns Roman frei.
Will man eine Traditionslinie für Der Gott des Sommers aufzeigen, so muss man wohl tatsächlich eher auf Martin Walsers „Ein springender Brunnen“ (1998) hinweisen, in dem der Erzähler den Erfahrungshorizont des Jungen Johann auch nicht kommentierend/reflektierend überschreitet und in größere historische Zusammenhänge ausgreifen lässt. In beiden Romanen kommt ein Wort aus dem Konnotationsfeld „Auschwitz“ nicht vor. Das ist nicht zu beanstanden, das ist erzählerisch stimmig und konsequent. Im Schreiben Rothmanns (wie Walsers) liegt ein Suchen, kein Wissen.
IV
Es ist ein enger räumlicher Kosmos – auch hier wiederum Walsers „Ein springender Brunnen“ nicht unähnlich -, in dem sich die Geschichte entwickelt. Louisas Leben konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei Orte: auf den Gutshof, der ihrem Schwager gehört, einem strammen SS-Offizier, und dem nahen Kloster, das zum Lazarett umfunktioniert wurde und in dem die Nonnen immer mehr schwerstverletzte Soldaten pflegen müssen. In die Wahrnehmung des Mädchens rückt zudem im Laufe des Romans ein Gefangenenlager in der Nähe, das von der Öffentlichkeit streng abgeschottet wird, und in der Ferne das immer mehr in Schutt und Asche fallende Kiel, in dem ihr Vater das Casino betreibt und deshalb nur sporadisch auf dem Hof auftauchen kann.
Rothmann gelingen in diesem Umfeld aufgrund der Genauigkeit seines Erzählens nachdrückliche Bilder fast unbeschreiblicher Trostlosigkeit, von Gewaltexzessen, aber auch Szenen großer Zartheit. Wie er es zum Beispiel schafft, die durchaus auch blutigen Schwierigkeiten bei der Geburt eines Kalbs erzählerisch zusammenzuführen mit der unsicher aufkeimenden Liebe Louisas zu dem Melker Walter Urban, weist den Autor als ganz großen Erzähler aus. Wer zweifelt, ob die geschilderten Assoziationen zu Werken von Autoren wie Fontane, Christa Wolf oder Walser nicht vielleicht doch eine Nummer zu groß seien, dem sei versichert, dass der Roman sich messen lassen kann, ohne Einbußen befürchten zu müssen.
V
Walter Urban! Es ist reichlich hingewiesen worden, auch durch den Verlag forciert, auf die Schnittmenge, die Der Gott jenes Sommers zum Erfolgsroman Im Frühling sterben (2015) aufweise. Ja, wir begegnen der Hauptfigur des Vorgängerromans, begegnen ihm in eindringlichen Szenen, erleben aber auch, dass er schnell wieder aus dem Blickfeld Louisas verschwindet, weil er eingezogen wird. Gegen Ende taucht er in der zerschlissenen Uniform eines GIs wieder auf, erneut mit einer eindrücklichen Szene, fast schon ein bloßer Schatten seiner selbst. Wir wissen warum. Mehr aber auch nicht. Der Gott jenes Sommers ist weder die Fortsetzung von Im Frühling sterben, noch eine Parallelgeschichte. Was die beiden Figuren am Ende in ihrer bodenlosen Erschütterung verbindet, ist von anderer als von bloß erzähltechnischer Art.
Bedeutsamer ist die zweite Handlungsebene, die in den Roman eingezogen ist. Sie durchbricht die Kontinuität des Erzählflusses immer wieder. Die Sprache frühneuzeitlicher Chroniken adaptierend, die eigene Sprachgestaltung dabei aber immer auch als Adaption kenntlich machend, erzählt ein Schreiber namens Bredelin Merxheim von einem Versuch, eine Kapelle auf einem Schiff über einen See hinweg in ein Dorf zu transportieren. In den Kriegswirren des 30-jährigen Kriegs, in die diese Expedition eingebettet ist, scheitert das Projekt und versinkt kurz vor dem Ziel im See. Der Chronist ist verzweifelt, erhält aber Trost von einem Handwerker, der das Scheitern umzudeuten versteht:
Frei und mittig sitzen wir unter dem Himmelsrund, und mag der Gott dieses Sommers unsere Nähe auch verschmähen – kann er sich denn weiter entfernen, als der Gedanke, der ihm gilt? Haben wir nicht alles dem Menschen Mögliche versucht? Unsere Fron, für die keiner nur einen Pfennig verlangte, ist kaum zu bezweifeln; jede Faser unseres schmerzenden Kreuzes zeugt für uns. Unser Bemühen war ein reines, also vollkommenes und konnte wahrhaftiger nicht sein, und somit ist alles gelungen, mein Bredelin: Wir haben, beim Lichte des Herrn besehen, das Ziel erreicht. Das Kirchlein, es steht an seinem Orte! – Bedenke er’s wohl!
Diese letzten Worte aus der eingeschobenen Chronik aus dem 30-jährigen Krieg machen deutlich, dass es sich bei diesen Erzählpassagen um mehr handelt als um eine bloße Analogiesetzung zwischen den Grausamkeiten der beiden großen Kriege über die Jahrhunderte hinweg. Das wäre ja fast schon ein wenig platt. In der Kombination von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit, dem also, was man gerade im barocken Kontext Vanitas nennt, und dem ausgewiesenen Gottesbezug öffnet sich die religiöse Ausrichtung des gesamten Romans.
In der Schlussszene, wohl kurz nach dem endgültigen Ende Kriegshandlungen, befindet sich Louisa in der Nähe der Klosterkapelle. An dem Sakralbau fallen die glänzenden Dachschiefer auf, er hat eine neue Glocke, über dem Türsturz ist das Horaz-Zitat „Non omnis moriar“ zu lesen, Ich werde nicht ganz sterben. Louisa selbst hat erschütternde Erfahrungen hinter sich: ihren Vater hat sie durch Selbstmord verloren, sie fand auch die Leiche. Ihre Schwester ist verschollen, anzunehmen, sie wurde wegen ihrer offenen Kritik an den „Nazis und das ganze Gesocks“ noch am Ende des Krieges verschleppt und ermordet. Louisa selbst wurde von ihrem Schwager im Keller von dessen Anwesen sexuell missbraucht. Kein Wunder also, dass das Mädchen glaubt, alles erlebt zu haben. Aus dieser Erfahrung heraus bekundet es im Gespräch mit einer Nonne, das den Roman beschließt, sie wolle selbst in den Orden eintreten. Sie äußert sich in dem Moment, in dem der Hund Motte, der an auffallenden Stellen im Roman leitmotivisch immer wieder in Erscheinung tritt und so die literarische Tierwelt Rothmanns um eine weitere Figur erweitert, seinen Kopf in den Schoß des Mädchens legt, um sich kraulen zu lassen. In dieser Schlussszene vereint Rothmann die Embleme der Melancholie mit einem Überlebensgestus, der sich in einen Gottesbezug stellt. Der wird noch dadurch bekräftigt, dass die Figuren im Gespräch auf die schon angesprochene Kapelle blicken: Ich sterbe nicht ganz.
Das mag manch einem zu fromm sein, aber nicht dem- beziehungsweise derjenigen, der sich die Alternativen im Leben zerschlagen haben. Eine Vita Contemplativa wird zur Option dort, wo sich die Angebote aus der Vita activa allesamt diskreditiert haben. Ob sie nun in der Religion enden oder im Schweigen, das eine Vielzahl der erwachsenen Figuren in Rothmanns Romanen prägt, macht letztlich kaum einen großen Unterschied. Louisa Norff ist eine typische Rothmann-Figur, durch und durch. Wie sie so geworden ist, wird beeindruckend erzählt.
Ralf Rothmann: Der Gott jenes Sommers. Roman. Berlin: Suhrkamp Verlag 2018 (22.- €)
Nachweis für den Hintergrund des Beitragsbilds: Pixabay
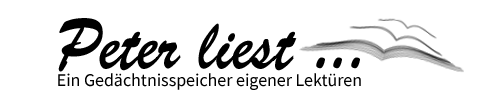

Wow! Welch eine beeindruckende Rezension! Da kann sich manch Kritiker eine Scheibe abschneiden. Ich habe Rothmann auch gerade gelesen und bin froh aus deinem Text noch einige Anhaltspunkte zur Aufschlüsselung erhalten zu haben. So wird der Roman für mich reicher, war ich doch ein klein wenig enttäuscht, weil er für mich nicht an „Im Frühling sterben“ heranreichte.
Viele Grüße!
Lieber Peter, ich habe deine Besprechung sehr gerne gelesen. Vor gar nicht langer Zeit habe ich “Feuer brennt nicht“ von Rothmann gelesen. Auch ein Buch, das sich sehr gelohnt hat und das zum Austausch einlädt, finde ich. Viele Grüße, Eva